“Repetitive Sequenzen und Loops, die sich langsam und subtil verändern” – Im Interview mit Philipp Pettauer (Fingers of God)

Fingers of God will perform on Saturday, 6. September at Pratersaune as part of Unsafe+Sounds Festival.
Auf deiner Webseite listest du vier Kategorien deiner Arbeit: ‘Music for Theatre’, ‘Music for Performances’, ‘Music for Film’ und ‘Music Releases’ – und daneben kuratierst du noch andere Künstler:innen für Events und Ausstellungen. Sind diese Säulen wirklich so klar getrennt; in welchen Verhältnissen stehen diese Produktionsformen zueinander?
Die Unterteilung dient eigentlich nur dazu, meinem Output eine Form von Struktur oder Ordnung zu geben. Obwohl ja eigentlich gerade die Kunst eine Sphäre ist, in der ich dieses kategorische Denken nicht anwenden will, merke ich immer wieder, dass es nicht einfach ist, sich dieser Logik zu entziehen, auch weil es manchmal einfach notwendig ist, das, was man tut, beschreibbar zu machen. So kommen dann vielleicht diese Kategorien zustande.
Ich erinnere mich an ein schon etwas älteres Interview von Mosca, in dem er über ein fast schon zwanghaftes Bedürfnis spricht, seine Musik in Genres einzuteilen. Ich möchte ihm jetzt nichts Falsches in den Mund legen, aber soweit ich es Erinnerung habe, hat er diese Zuschreibungen, die ja in erster Linie von Außen kommen, als eine Art Notwendigkeit in einer Clubkulturökonomie bezeichnet, die ja v.a. dazu dient, Artists vermarktbar zu machen, sei es über Programmtexte, Flyer, Pressetexte – je klarer und eindeutiger, desto besser. Diese Genre-Zuschreibungen sind von dem her natürlich auch immer vage und nicht selten irreführend, weil du versuchst, etwas Komplexes wie Sound auf einzelne Begriffe zu reduzieren.
Um auf deine Frage zurückzukommen: ja, diese Säulen haben natürlich alle auch miteinander zu tun und beeinflussen sich wechselseitig, weil es ja am Ende um das gleiche Medium, also Musik geht und dieselbe Person dahinter steht. Unterschiede gibt es allerdings trotzdem. Wenn ich Musik für Theater oder Film mache, arbeite ich in Abstimmung mit anderen und habe natürlich eine andere Herangehensweise, als wenn ich als Fingers Of God Musik produziere, wo ich mehr oder weniger frei entscheiden kann, was ich machen will.

Wie bist du zu deiner aktuellen Musik-Praxis gekommen?
Musik studiert habe ich nicht, aber ich hatte während meiner Schulzeit einige Jahre Klavierunterricht. Irgendwann bin ich dann mit House und Techno in Kontakt gekommen. Das hat mich total begeistert und ich wollte ab da nur noch diese Art von Musik machen. Klavierspielen war dann nicht mehr so interessant.
Damals war für ganz lange Zeit Oliver Chesler (The Horrorist) mein wichtigster Einfluss. Ihn habe ich über diesen Track Extreme Terror entdeckt, der damals in so einer Herr der Ringe Parodie vorgekommen ist, und ich wollte dann unbedingt Musik machen, die genauso klingt. Es gab damals in diesen Kellogg’s Müslipackungen diese Freeware Versionen von Magix Music Maker. Damit hab‘ ich viel herum probiert und die ersten eigenen Tracks gemacht. Ich habe mir dann später Cubase zugelegt und ja, wirklich einfach viel probiert. Für mich war die Vorstellung, eigene Tracks mit allen erdenklichen Sounds selbst machen zu können, unglaublich. Klar hat damals vieles noch nicht so toll geklungen, aber das war egal bzw. ist es mir damals auch nicht so vorgekommen. Da ging es noch nicht darum, mit dieser Musik einmal etwas zu erreichen oder machen zu wollen, sondern einfach nur um eine Faszination für die Möglichkeiten, die sich gerade auftun. Und ja, mit der Zeit entwickeln sich dann so bestimmte Systeme oder Routinen heraus. Ich habe z.B. ein Verständnis dafür bekommen, welche Effekte cool klingen, oder was passiert, wenn ich diesen oder jenen Regler verschiebe. Das allermeiste war aber weniger ein genaues technisches Verständnis von dem, was jetzt z.B. der Release-Wert von einem Kompressor genau macht, sondern einfach so ein pragmatisches Wissen darüber, dass wenn ich jetzt diesen oder jenen Parameter verändere, der Sound dann so oder so klingen wird. Ich bin dann später auf Ableton Live gewechselt, bin aber am Ende wirklich der Überzeugung, dass es nicht um dein Equipment geht oder welches Gerät, welches Programm oder Plugin du verwendest. Das Tolle ist, dass du heute ohne irgendein teures Studioequipment zu besitzen, in relativ kurzer Zeit schon sehr gut klingende Musik produzieren kannst. Im Prinzip reichen dafür ein Smartphone und Kopfhörer. Auch die Qualität der Stockplugins in z.B. Ableton hat sich in den letzten Jahren enorm verbessert und es gibt mittlerweile wirklich sehr gute Kanäle auf YouTube, von denen man viel lernen kann.
Deine EP Lens Shift, ist Anfang des Monats auf dem New Yorker Label Dance Data erschienen. Was ist ein Lens Shift eigentlich?
Die Titel sind eher assoziativ gedacht. Bei Lens Shift hat mir einfach die Ästhetik des Begriffs gefallen, wie es aussieht, wenn die Wörter nebeneinanderstehen, wie es klingt, wenn man sie ausspricht und ich hatte den Eindruck, dass es ganz gut zum Titeltrack passt.
Wie kam die EP und Kollaboration mit dem Label zustande? Die Vinyl ist laut Bandcamp schon ausverkauft!
Jesse hat mich vor zwei Jahren im Sommer per Mail kontaktiert und mir davon erzählt, dass er ein neues Label, Dance Data, gestartet hat und dafür gerne einen Release mit mir machen würde. Ich kannte Jesse davor gar nicht, aber fand die ersten zwei Releases, die bereits veröffentlicht wurden, sehr gut und hab dann im Sommer begonnen, an der EP zu arbeiten. Erste Versionen von D-Warp und Gyro Drop gab es bereits, Redux und Lens Shift sind dann im Sommer entstanden. Jesse hat auch Feedback auf die Tracks gegeben und ich hab‘ ihm immer wieder Updates geschickt. Eigentlich war die EP dann schon im Herbst 2023 fertig, aber es hat dann irgendwie doch länger gedauert, bis sie jetzt tatsächlich erschienen ist.

“Ich mag diesen kreativen Prozess in der Klangforschung sehr”
Ästhetisch sind die fünf Titel schwierig zuzuordnen, was natürlich super ist. Neben Breaks und eindeutigeren Clubsounds lassen luftigere Tracks wie D-Warp und Lens Shift viel Raum für Sounddesign und Tonkaskaden, Andeutungen. Sie dehnen Trackstruktur und Spannung aus: wie würdest du selbst den Sound der EP beschreiben?
Zu der Zeit, als ich Lens Shift produziert habe, habe ich grade viel Jersey Club gehört und ältere Night Slugs Releases wiederentdeckt. Das ist ein Einfluss, den man vor allem beim Titeltrack raushört. Redux hat ein Grundpattern, das an Drum and Bass erinnert und bekommt dann durch eine repetitive Melodiesequenz diesen hypnotischen Charakter, der mir an Techno immer schon gut gefallen hat und ein zentrales Element der Musik ausmacht, die mich als Fingers Of God interessiert. Diese repetitiven Sequenzen und Loops, die sich langsam und subtil verändern, finden sich auch in den Tracks auf Lens Shift, die trotz den von dir erwähnten, teilweise auch bewusst ausgedehnteren Spannungsbögen am Ende doch immer zu ihrer Trackstruktur zurückkehren und um ein sich wiederholendes Thema bzw. eine Melodiesequenz kreisen.
Klar gibt es in meiner Musik auch ein Moment der Dekonstruktion und es ist spannend, mit Konventionen und bestimmten Erwartungen an einen Clubtrack zu spielen. Mir ist aber wichtig, dass die Tracks trotzdem noch als solche funktionieren. Ich behalte beim Produzieren immer im Hinterkopf, dass die Tracks später in DJ-Sets oder Clubs gespielt werden und in diesem Kontext auch gut funktionieren. Das trifft auch auf das Sounddesign zu. Ich mag diesen kreativen Prozess in der Klangforschung sehr. Das ist meistens auch die Phase, die am Anfang der Track-Entwicklung steht. Aber ich möchte vermeiden, dass Sounddesign zu einem Selbstzweck oder zu Effekthascherei wird. Mich interessiert dann vor allem wie ich diesen besonderen Sound, oder diesen speziellen Effekt, sinnvoll in die Struktur und Form eines Clubtracks integrieren kann. Oft sind es dann genau diese Elemente, die einen Track besonders machen.
Du bist in Kärnten aufgewachsen, nach der Schule nach Wien gekommen: wie würdest du die Wiener bzw. österreichische Elektronikszene den Labelkolleg:innen in New York beschreiben?
Mittlerweile sehr abwechslungsreich und vielfältig. Als ich vor 14 Jahren von Kärnten nach Wien gezogen bin, gab es gefühlt eigentlich fast überall nur House und Disco, das ist erfreulicherweise doch um einiges offener geworden. Und es gibt durchaus auch größeres Interesse an experimentelleren Ansätzen und hybriden Formaten mit DJ Sets & Live Konzerten.
Bist du zufrieden mit der Szene- und Clublandschaft in Wien?
In den letzten Jahren hat sich einiges getan und es sind viele neue spannende Projekte und Veranstaltungsreihen gestartet worden. Was die Clublandschaft betrifft, so wird es ohne Förderungen immer schwieriger, Veranstaltungen zu realisieren. Will man alle Beteiligten fair bezahlen, sich selbst nicht ausbeuten und gleichzeitig Personen nicht aufgrund hoher Eintrittspreise von der Teilhabe ausschließen, lässt es sich kaum ohne Förderungen bewerkstelligen. Es ist gut, dass Clubkultur zunehmend auch in der Wahrnehmung von Fördergeber:innen als etwas kulturell Wertvolles und nicht nur als reines Entertainment betrachtet wird, obwohl es natürlich auch viele unterstützenswerte Projekte und Veranstalter:innen gibt, die davon ausgeschlossen sind, die keine Förderungen bekommen. Und auch die Suche nach geeigneten Locations hat uns mit Unfollow immer wieder vor Probleme gestellt – es gibt Bedarf nach mehr Orten, die zum einen eine gute Infrastruktur bieten, zum anderen aber auch ein Verständnis für Clubkultur mitbringen und Veranstaltungen nicht ausschließlich nach dem gemachten Barumsatz beurteilen.
“ich bin durchaus offen dafür, mit gewissen Klischees zu spielen”

Du bist auch als Produzent und Komponist am Theater tätig. Ich lerne immer mehr Producer:innen kennen, die früher oder später beginnen für die spezifische Institution Theater arbeiten und Teile ihres Werkes in diese Richtung lenken. Beobachtest du das auch? Woher kommt diese Nähe?
Das kann gut sein. Ich denke, dass eine so stark institutionalisierte Einrichtung wie ein Theaterhaus immer vor der Herausforderung steht, künstlerisch “aktuell” zu bleiben. Da bietet es sich ganz gut an, immer wieder außenstehende Personen in die Produktionen zu holen, die nicht diese Bindung zu der Institution und vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge haben. Ich habe schon den Eindruck, dass es vielen Theaterschaffenden wichtig ist, zeitgenössische Ästhetiken in ihre Arbeit einfließen zu lassen, von dem her ist eine Nähe zur Clubmusik, experimenteller elektronischer Musik, aber auch Popkultur angebracht und notwendig.
Sind in der german speaking world Theaterhäuser vielleicht auch angenehmere Arbeitgeber als die derzeit kränkelnde Festival- und Clublandschaft?
Es ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Wobei die Honorare nicht immer mit dem tatsächlichen Arbeitsaufwand übereinstimmen, was auch damit zu tun hat, dass der Musik nicht in allen Theaterhäusern derselbe Stellenwert zukommt. Klar ist, dass die ökonomische Lage vieler Musiker:innen prekär ist. Es ist den meisten einfach nicht möglich, sich allein durch Auftritte und Veröffentlichungen zu finanzieren. Arbeitsmöglichkeiten in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Theater leisten einen Beitrag zur Existenzsicherung.
“in eine andere Welt einzutauchen”

Letztes Jahr ist mit Blutbuch eine LP mit deinen Kompositionen für das gleichnamige Theaterstück erschienen. Hast du den Anspruch, dass diese Musik auch für sich – also ohne Szenerie und Schauspieler:innen – funktioniert?
Nicht unbedingt. Ich habe eher den Eindruck, dass die meisten Tracks für sich allein gar nicht so spannend sind und die Sounds erst im Zusammenspiel mit den anderen Ebenen, wie Licht, Kostüm, Bühne, Szene, und Schauspiel, Sinn ergeben. Dazu kommt, dass ich die Musik ja auch an die Gegebenheiten des Bühnenraums und den Sound vor Ort anpasse. Das heißt dass die Musik auch auf das spezielle Setting zugeschnitten ist. Der Blutbuch-Soundtrack ist da eher die Ausnahme. Bei der Arbeit an Blutbuch war es so, dass ich im Zuge der Vorbereitung das Buch gelesen habe und parallel dazu Themen zu bestimmten Szenen und Abschnitten entwickelt habe, die tatsächlich dann auch die Grundlage für die spätere Musik auf der Bühne waren. Die Arbeit an Blutbuch war auch deshalb besonders, weil der Text sehr speziell ist und im Buch selbst schon sehr abwechslungsreiche Welten und Szenarien aufgemacht werden. Da gibt es zum Beispiel einen Rückblick auf die Kindheit, in der eine sehr mystische Welt beschrieben wird, die mir auch für die Musik viel Inspiration geboten hat. Ich mag es eigentlich sehr gerne, wenn Theater auch manchmal Raum für Imagination lässt und nicht-realistische Settings auftauchen. Es ermöglicht mir, in eine andere Welt einzutauchen.
Gibt es musikalische Formen, die du am Theater ablehnst oder zumindest nicht gerne lieferst? Etwa Klischees oder Ideen, für die du nicht einstehst?
Ich denke das ist ähnlich wie bei Filmmusik – da haben sich bestimmte Konventionen herausgebildet, wie durch Sound Emotionen oder Stimmungsbilder verstärkt werden können. Das findest du in ähnlicher Weise natürlich auch im Theater. Ich schaue zum Beispiel gerade zum ersten Mal die Serie Lost, die jetzt auch schon 20 Jahre alt ist, und die ist auf ganz vielen Ebenen total klischeebeladen, vor allem eben auch, was die Musik anbelangt. Natürlich wirken da die pathetischen, dick aufgetragenen Streicher irgendwie aus der Zeit gefallen und ungewollt komisch. Gleichzeitig merke ich aber, dass ich dem trotzdem auch etwas abgewinnen kann. Vielleicht ist das auch einer Form von Nostalgie geschuldet. Was meine Arbeit im Theater betrifft, bin ich durchaus offen dafür, mit gewissen Klischees zu spielen, gerade weil das Theater ja voll ist mit Referenzen, Verweisen und Anspielungen. Worin ich eher eine Gefahr sehe ist, wenn es während der Proben nicht genug Zeit gibt, du unter Zeitdruck kommst und dann bestimmte Stellen oder „Löcher“ schnell mit Sound gefüllt werden sollen. Da passiert es dann auch immer wieder, dass ich mir am Ende denke, das hätte ich gern anders gemacht, weil ich mich auch selbst dabei ertappe, in Klischees zu fallen.
Schon mal einen Wunsch von der Regie verweigert?
Klar gibt es immer wieder auch Reibungspunkte. Ich denke, in so einem Fall geht es dann eher darum auszuverhandeln, warum man gewisse Ideen oder Wünsche nicht gut findet. Im Idealfall findet sich eine Lösung, die sowohl für mich vertretbar ist, als auch mit den Vorstellungen der Regie zusammenpasst.

Denkst du, dass deine Musikproduktionen, also deine Musik-Musik, sich verändert hat, seit du viel für Bühnen, Performance, Film arbeitest bzw. für andere Menschen produzierst?
Schwer zu sagen, ich glaub meine Musikproduktionen verändern sich sowieso die ganze Zeit und sind von allen möglichen Dingen beeinflusst, seien es Filme oder Bücher oder auch die Arbeiten von anderen Künstler:innen. Manchmal übernehme ich sicher auch bestimmte Techniken oder Sounds, die ich einmal in einer Theaterproduktion verwendet habe für Fingers Of God Tracks. Dasselbe gilt aber auch umgekehrt.
Wie geht es weiter, was steht im Sommer an?
Es stehen noch drei Staffeln Lost an, die mich einige Zeit beschäftigen werden. Im Herbst steht dann ein Projekt in Klagenfurt an, auf das ich mich schon freue!
Vielen Dank für das Interview!

Fingers of God
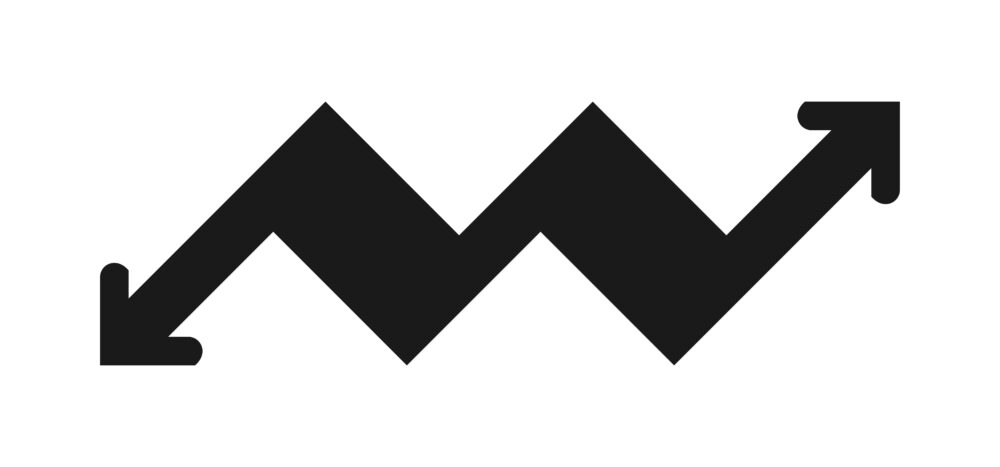
This article is brought to you by Struma+Iodine as part of the EM GUIDE project – an initiative dedicated to empowering independent music magazines and strengthen the underground music scene in Europe. Read more about the project at emgui.de
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.