EM GUIDE: Gedanken über Selbstständigkeit und Absicherung – (k)ein Goldenes Zeitalter
“Nur mit gerechter Vergütung und guter sozialer Absicherung können Künstler ihre Werke schaffen“, schrieb Thorsten Schäfer-Gümbel 2017 in der SPD-Partei-Zeitung Vorwärts und verband seine eigene Analyse mit Forderungen für die Künstler.innenschaft: Zugang zur Arbeitslosenversicherung über die Künstlersozialkasse; Mindestvergütung für Musiker.innen etc.
Die SPD, obwohl seit 2013 durchgängig in Regierungsverantwortung auf Bundesebene, hat den Propheten im eigenen Laden nicht weiter beachtet, weswegen erst 2024 von (ausgerechnet) der schwarz-grünen Regierung in NRW ein Vorstoß im Bundesrat Bewegung in die Sache gebracht hat. Sie lässt derzeit prüfen, ob selbstständige Künstler.innen den Empfänger.innen von ALG1 gleichgestellt werden können (die Noies berichtete in Ausgabe 01/25). Darüber hinaus hat sie gerade ein Modell für Mindesthonorare verabschiedet, die stufenweise eingeführt wird.
Das sind wahrlich nur kleine Schritte, die dennoch das Leben von solo-selbstständigen Künstler:innen im Allgemeinen und von Musiker:innen im speziellen deutlich verbessern könnten. Einer Berufsgruppe, die nach Erhebungen der Gewerksschaft VERDI besonders prekär und häufig nur unwesentlich über der Armutsgrenze lebt. Nicht nur deshalb ist in Deutschland, so zeigt sich im europäischen Vergleich, viel Luft nach oben bezüglich der sozialen Absicherung der Musiker:innenschaft.
Dabei wissen wir bereits seit dem 17. Jahrhundert, das eine umfängliche finanzielle Unterstützung von Künstler:innen nicht nur selbstzwecklich ist, sondern einen wirtschaftlichen Faktor darstellt. In den Niederlanden entstand erst auf privat-bürgerliche Initiative, später auf staatlich-administrativer Ebene ein Netz an Unterstützungs- und Förderungsmechanismen, die das relativ zu seinen europäischen Nachbarn Deutschland, dem UK und Frankreich kleine Land zu einem bedeutenden Ort der Kultur machte. Die sich daraus ergebenden, hervorragenden staatlichen Sammlungen voller Schätze der Kunst- und Kulturgeschichte ziehen immer noch Millionen Besucher:innen jedes Jahr an. Gerade in der zweiten Hälfte der 20. Jahrhunderts wurden Amsterdam, Maastricht, Rotterdam, Utrecht und noch viele weitere Städte nicht nur zu touristischen Zielen, sondern konnten jedes Jahr Hunderttausende Talentierte an ihre Hochschulen für Kunst und Musik locken. Der Blick auf das westliche Nachbarland ist besonders interessant: 2012 brach man mit der eigenen Tradition und hob das letzte übriggebliebene Gesetz, das sogenannte WWIK (Wet Werk en inkomen Kunstenaars) zur speziellen Absicherung von Künstler:innen, auf. Dieses Gesetz, das einen staatlichen Zuschlag zum Verdienst vorsah, sollte Künstler:innen ihre Lebenserhaltungskosten für eine Zeitdauer von vier Jahren absichern, insofern diese nicht selbst erbracht werden konnten. Mit dieser Maßnahme konnten Phasen künstlerischer Neuorientierung, Entwicklung neuer Techniken oder tiefergehender Recherchen überbrückt werden. Seit der Abschaffung des Gesetzes sind Künstler:innen auf sich alleine gestellt bzw. werden wie reguläre Selbstständige behandelt und fallen in Phasen niedriger Erträge auf die Sozialhilfe zurück. Diese erfordert sodann – wie man es hierzulande von Hartz IV kennt – die Verpflichtung zu Bewerbungen auch außerhalb des eigenen Tätigkeitsfelds, inklusive drohenden Sanktionen bei ausbleibender Mitwirkung, wie man es Amtsdeutsch ausdrücken würde.
Dagegen wirken die Bedingungen in Frankreich geradezu phänomenal. Wer in Frankreich als Musiker:in, Choreograph:in oder Multimediakünstler:in tätig ist und mindestens 7.443 Euro im Jahr verdient, wird bei der AGESSA (Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs) pflichtversichert. Wer diese Grenze nicht erreicht, kann vor einer Kommission seine regelmäßige künstlerische Arbeit darlegen und wird nach Prüfung zu denselben Bedingungen versichert. Die Krankenversicherung umfasst auch Krankengeld ab dem 4. Tag sowie Leistungen im Mutterschutz oder auch im Falle von Invalidität. Als Quasi-Dienstgeberbeitrag fungiert eine Verwerterabgabe, welche die Nutzer von künstlerischen Leistungen bezahlen: sie berechnet sich als 1% auf alle Lizenzgebühren (urheberrechtliche Nutzungsentgelte), die sie pro Jahr bezahlen und als Beitrag für per Werkvertrag beschäftigte Künstler/innen. (Ähnlich der in Deutschland abzugebenden Beiträge für die Künstlersozialkasse)
Darüber hinaus können Musiker:innen eine Art Grundeinkommen, das Intermittenz genannt wird, beantragen. Diese monatliche Zahlung erhalten jene Musiker:innen, Tänzer:innen und Schauspieler:innen, die mehr als 507 Stunden im Jahr auf Bühnen – darunter zählen bedingt auch (Konzert-)Clubs – künstlerisch arbeiten. Beide Säulen, die im Vergleich zu Deutschland weitgehendere Soziale Absicherung sowie die Intermittenz, sorgen hierbei nicht nur für eine Entprekarisierung künstlerischer Arbeit, sondern nivellieren auch geschlechterspezifische Marginalisierung. Gerade die Absicherungen rund um Schwangerschaft und die Geburt – in Frankreich gepaart mit einem engmaschigen staatlichen System der Betreuung von Kindern – sorgt für einen kleineren „gender pay gap“ (Frankreich: 12,2 %, Deutschland: 17,6%; Stand 2023)
Auf Rückfrage bei französischen Musiker:innen wurde uns aber beschrieben, dass hier von Fall zu Fall entschieden wird. Während Komponist:innen, die oft an staatlichen Häusern wie Theater oder Philharmonien tätig sind, keine Probleme mit dem Zugang haben, wird Musiker:innen aus der elektronischen Tanzmusik oder Experimentalmusik oft die Zahlung verwehrt. Gründe dafür sind die fehlende Anerkennung von kleinen Club-ähnlichen Spielorten oder zu viele Gigs im Ausland. Eine Klärung oder Novelle des Gesetzes stand bereits 2022 an, wurde bis heute aber nicht angegangen.
Auch in Irland gibt es derzeit (noch) ein künstlerisches Grundeinkommen. Das BIA (Basic Income for the Arts) ist ein testweises laufendes Projekt, das während der Coronakrise erdacht wurde und im August 2022 in Realität umgesetzt wurde: 2000 irische Künstler:innen erhalten wöchentlich 325€. Nach dem Ende des Testballons im August 2025 möchte der Dáil Éireann, das irische Unterhaus, noch bis Januar 2026 entscheiden, ob man das Experiment für gescheitert erklärt oder bereits im Laufe des Jahres als generelles Recht für irische Künstler:innen gesetzlich festschreibt. Politischen Beobachtern zufolge scheint die bürgerlich-konservative Regierung in Dublin, die Ende 2024 die Regierungsgeschäfte übernommen hat, prinzipiell kein Interesse an der Fortführung beziehungsweise Ausweitung eines (bedingungslosen) Grundeinkommens für Künstler:innen zu haben. Indes profitieren Künstler:innen bereits seit 2017 an einem erleichterten Zugang zu Sozialleistungen, inklusive Überbrückungsgelder für auftragsarme Phasen.
In Island hingegen gibt es den “Listamannalaun“. Allgemein betrachtet handelt es sich hierbei um einen Förderungsfonds des isländischen Staats. Auf diesen Fonds können sich alle selbstständigen Künstler:innen in Island bewerben, er sichert ein monatliches Gehalt von 3700 Euro Brutto ab – bei im Verhältnis deutlich höheren Lebenserhaltungskosten wohlgemerkt. Die totale Zahl der geförderten Künstler:innen fällt mit 241 im Jahr 2024 sehr klein aus; hinsichtlich einer Gesamteinwohnerzahl um die 350.000 Einwohner:innen und nur 1500-2000 selbstständigen Künstler:innen bedeutet das dennoch, dass etwa jeder zehnte auf diesem Wege abgesichert wird. Ein Modell, das sicherlich nicht auf einen Flächenstaat mit 80.000.000 Einwohner:innen anzuwenden ist, für Klein- und Kleinststaaten lässt sich mit einem derartigen Fonds eine relativ gute (Grundeinkommen-ähnliche) Versorgung für Künstler:innen garantieren, die unterdessen kaum finanzielle Belastung bedeutet. Gleichzeitig können solche Förderstrukturen einen wirtschaftlichen Faktor bedeuten.
Die Unterstützung von Künstler:innen, ob in Form eines Grundeinkommen und ähnlicher monatlicher Auszahlung oder als Befreiung von bestimmten Sozialabgaben, ist nie kultureller Selbstzweck, sondern steht stets in einer Reihe mit vergleichbaren Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Dass Staaten über Maßnahmen ihre Wirtschaftszweige unterstützen, damit auch steuern, ist staatswirtschaftliche Realität. In den Niederlanden, in Schweden, besonders in Frankreich und Deutschland wird diese Steuerungsfunktion gleichsam durch eine starke Betonung der Kunst als unbedingter und fester Bestandteil der kulturellen, nationalen Identität (“Land der Dichter und Denker“) verschleiert; Kulturförderung und -absicherung wird entsprechend als Selbstzweck missverstanden. Aber: Kein Land in der EU offenbart die einzig ideologische Begründung für kulturelle Förderung wie das autokratisch-regierte Ungarn. Hier sind freie Künstler:innen (von Bildender Kunst bis zur Musik) nicht nur unter ständiger Beobachtung, ihnen drohen bisweilen Repressalien; nein, die Regierung Orbán hat in den letzten Jahren durch ihre Gesetzgebung bewiesen, wie man durch Sonderregelungen „nationale Identität stiftet“: Orbán führte eine Künstler:innenrente ein. Pferdefuß an der Sache ist, dass sich nur zwei Gruppen für diese Rente qualifizieren: Ballett- und Folkloretänzer und zum anderen die Künstler, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und eine besondere Auszeichnung erhalten haben. Um eine Rente zu erhalten, müssen Ballett- und Folkloretänzer die folgenden Bedingungen erfüllen: Mitgliedschaft in einem der acht definierten Tanz-Ensembles; eine mindestens 25-jährige Tätigkeit als Tänzer:in bei den definierten Ensembles; das reguläre Rentenalter darf noch nicht erreicht sein. Neben Tänzer:innen können auch Inhaber von Sonderpreisen Künstlerrenten beantragen. Diese Initiative wurde 2018 ins Leben gerufen und von der Ungarischen Akademie der Künste (MMA) organisiert. Ein Antragsteller auf eine Künstlerrente muss mindestens 65 Jahre alt sein. Über eine genau definierte Liste der Auszeichnungen wurde festgelegt und sichergestellt, dass ausschließlich nationalistische, im Sinne des starken Nationalstaats Ungarn wirkende Künstler:innen diese Rente erhalten können. Ein warnendes Beispiel dafür, dass vorgeblich emanzipative und die Autonomie der Künste fördernde Maßnahmen durchaus missbraucht werden können.
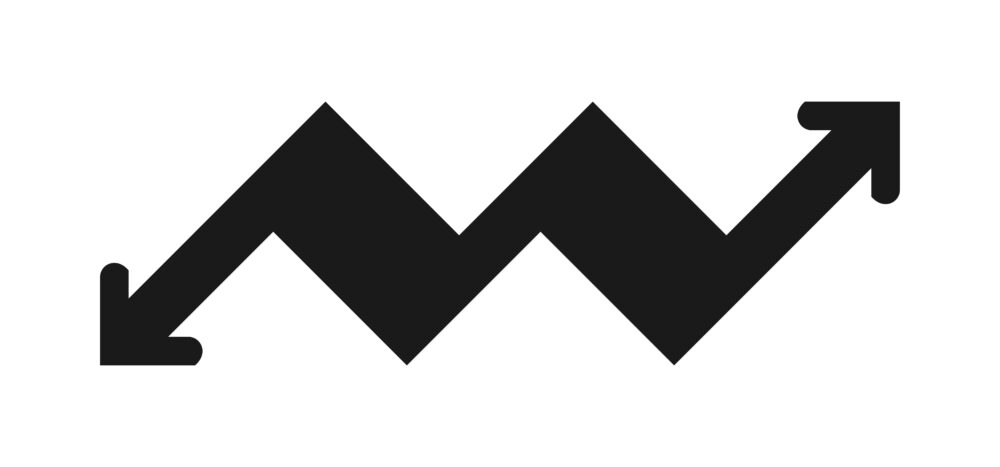
This article is brought to you by ON Cologne as part of the EM GUIDE project – an initiative dedicated to empowering independent music magazines and strengthen the underground music scene in Europe. Read more about the project at emgui.de
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.